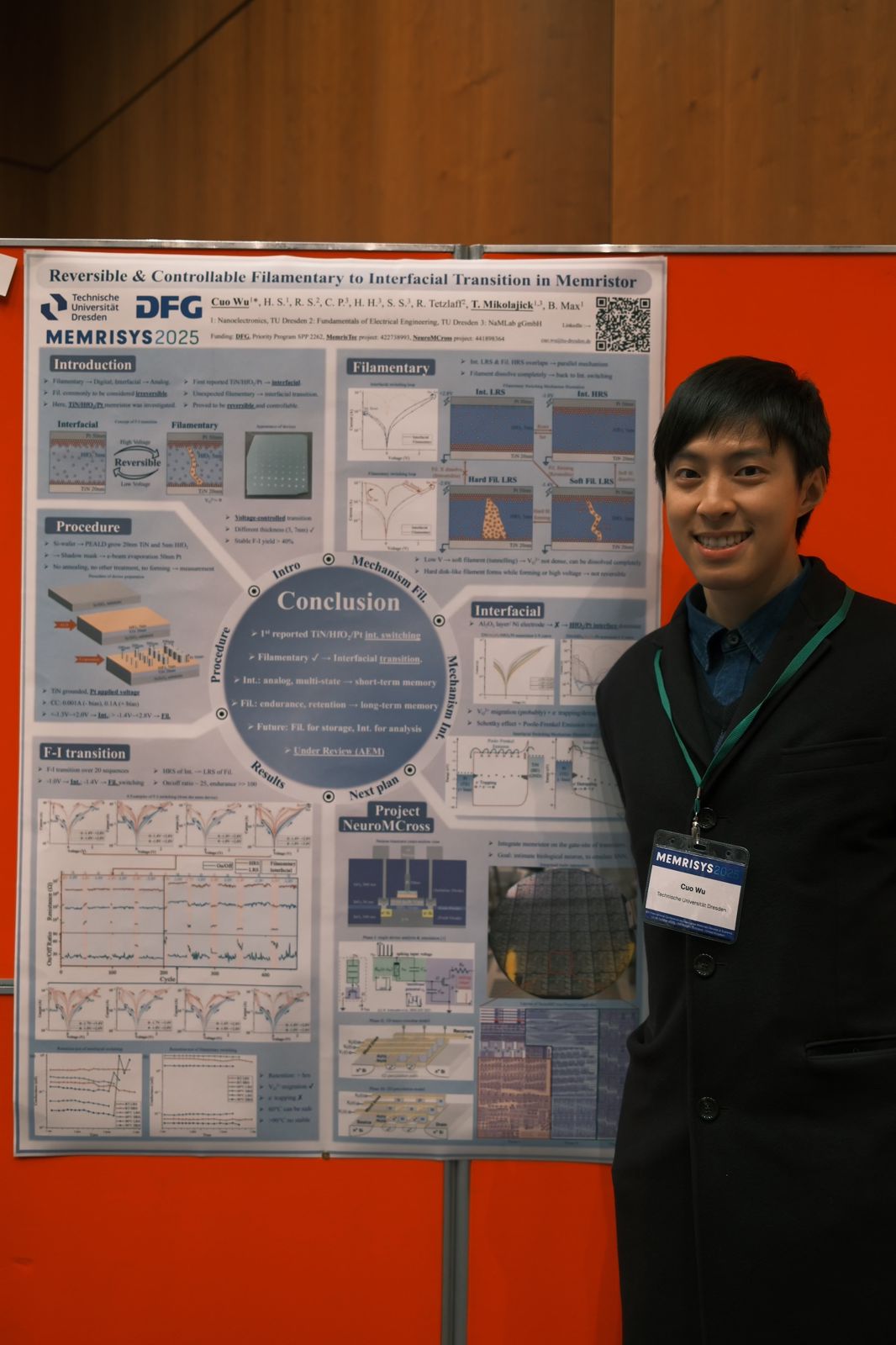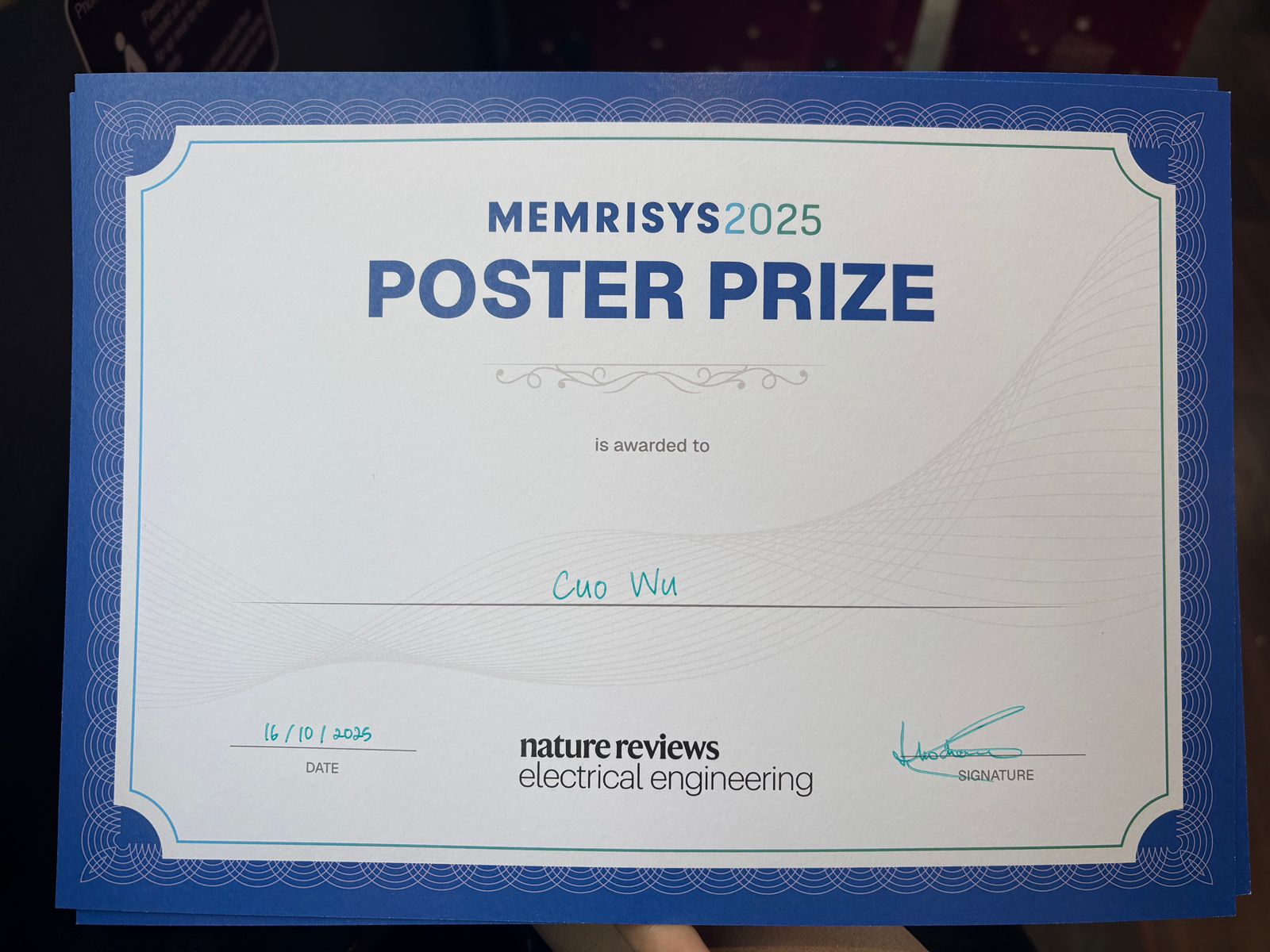Elektronik in den Weltraum zu schicken, ist keine leichte Aufgabe. Im erdnahen Orbit stellen Strahlung, extreme Temperaturen und das Vakuum Herausforderungen dar, denen herkömmliche Speicher nicht standhalten können. Das LEOMEM-Projekt, Teil des DFG-Schwerpunktprogramms MemrisTec und ab 2025 von der DFG gefördert, widmet sich diesen Herausforderungen. Forscher der TU München, der Universität Rostock und des IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik unter der Leitung von Prof. Amelie Hagelauer, Prof. Marc Reichenbach und Prof. Christian Wenger entwickeln strahlungsresistente RRAM-basierte Speicherzellen und bauen dabei auf den Ergebnissen des früheren MIMEC-Projekts auf.
Erste Chip-Prototypen, die Transistoren mit geschlossenem Layout (ELTs) mit RRAM-Bauelementen kombinieren, wurden bereits am IHP hergestellt. Diese Zellen werden mehrstufigen Tests auf Gesamtionisierungsdosis (TID), Einzelereigniseffekte (SEE) und extreme Temperaturen unterzogen. Könnte der Speicher diesen harten Bedingungen standhalten und gleichzeitig energieeffizient bleiben? Das ist eine der zentralen Fragen, die LEOMEM beantworten möchte.
Auf Systemebene fließen Verhaltensdaten der Geräte in ein Design-Framework ein, um sichere und adaptive Speicherarchitekturen zu erforschen. Adaptive Fehlerkorrekturcodes arbeiten neben analoger Steuerung, digitalen Schnittstellen und Controllern in einem vollständig integrierten ASIC-Prototyp. Das ultimative Ziel ist ein Speichersystem, das auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Leistung bei Weltraummissionen optimiert ist und den Weg für die nächste Generation des In-Memory-Computing jenseits der Erde ebnet.